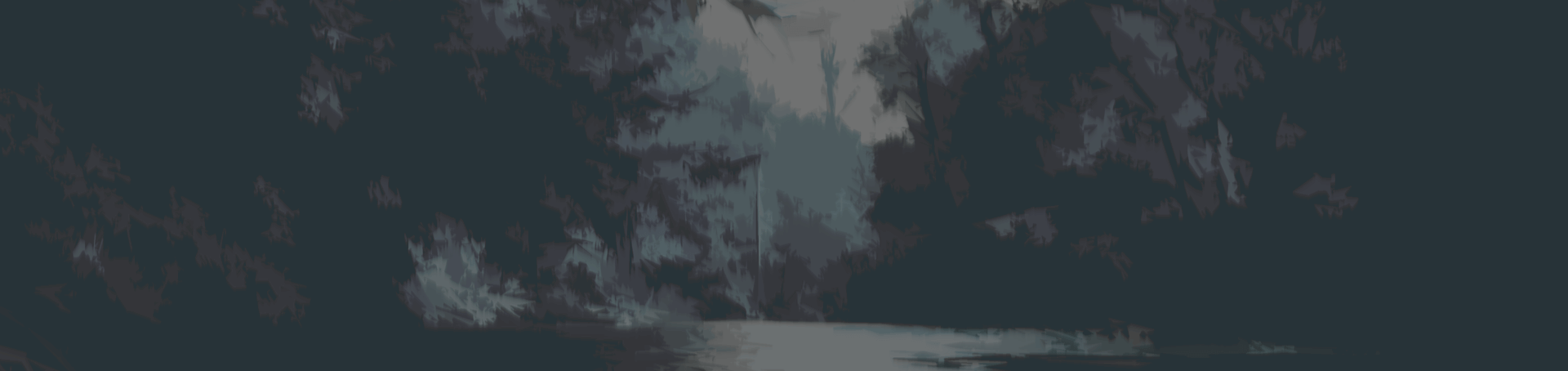58
von tai
Zufälligerweise hab ich viel damit zu tun. Vielleicht interessierts jemanden, auch wenns etwas ausführlicher ist.
3.2 Epidemiologie der Störungen des Sozialverhaltens
Nach neueren Studien muss mit einem Auftreten psychischer Störungen bei etwa jedem fünften Kind gerechnet werden (Steinhausen, 2002, S. 21), wobei die Gruppe der von Störungen des Sozialverhaltens betroffenen Kindern und Jugendlichen mit etwa 30 bis 50% der Zuweisungen einen recht hohen Anteil einnimmt. Studien zufolge liegt der Anteil der von Störungen des Sozialverhaltens betroffenen Kinder und Jugendlichen durchschnittlich bei bis zu acht Prozent, wobei die Zahl der Jungen zwischen sechs und sechzehn Prozent und bei Mädchen zwischen zwei und neun Prozent variiert (Petermann, Döpfner & Schmidt, 2001, S. 8). Im Kleinkindalter liegt die Rate bei etwa zwei Prozent.
.
.
.
3.3 Epidemiologie der Aggressivität
Aggressive Verhaltensweisen liegen in der bundesweiten Studie zur Häufigkeit psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter (PAKD- KID) dem Urteil von Eltern zufolge bei drei Prozent der Mädchen und sechs Prozent der Jungen vor. Ausgeprägte Formen dissozialen Verhaltens sind nach dieser Studie bei 1,5 Prozent der Mädchen und drei Prozent der Jungen im Alter von elf bis achtzehn Jahren festzustellen (Petermann, Döpfner; Schmidt, 2001, S. 9). In Selbstbeurteilungsverfahren von Kindern und Jugendlichen divergieren die Angaben mit deutlich höheren Raten, ebenso werden die Geschlechtsunterschiede revidiert.
Aggressives Verhalten zählt somit zu den am häufigsten ermittelten Störungen. Oftmals tritt dieses Verhalten zusammen mit delinquenten Verhaltensweisen in Erscheinung. Komorbide Störungen wie bspw. Oppositionelles Trotzverhalten, Aufmerksamkeitsstörungen oder Depressionen sind im Zusammenhang mit Aggressivität häufig (Scheithauer & Petermann, 2000a , S. 192).
3.4 Epidemiologie der Delinquenz
Delinquentes Verhalten von Kindern und Jugendlichen äußert sich meist in Form von Eigentumsdelikten wie Ladendiebstahl oder Einbruch sowie durch Konsum illegaler Substanzen. Zu den weniger häufig verübten Delikten sind schwere Gewalttaten wie Körperverletzung, Tötungsdelikte oder Sexualstraftaten zu zählen.
Verlässliche empirische Daten über Ausmaß und Verbreitung von Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen sind schwer zu erheben. Kriminalstatistiken erfassen nur Taten, die angezeigt oder ermittelt werden, jedoch nicht das so genannte Dunkelfeld. Die Höhe der ermittelten Kriminalitätsrate hängt vom Anzeigeverhalten der Bevölkerung und der personellen Ausstattung, bzw. den Ermittlungsstrategien der Polizeibehörden ab (Schäfers & Scherr, 2005, S. 174).
Als Beispiel sei hier der Fall eines 17jährigen angeführt, gegen den innerhalb eines Jahres fünfmal wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wurde, was in jedem dieser Fälle zu gerichtlich angeordneten Sanktionen führte. Nach eigenen Angaben war der Jugendliche innerhalb der letzten zwei Jahre jedoch in mehr als 100 Schlägereien verwickelt und hat mehrere Einbrüche und Diebstähle begangen. Die Taten führten jedoch nur insgesamt fünfmal zu Ermittlungen seitens der Polizei und zur Verurteilung vor Gericht.
Vorliegende Studien in Bezug auf die mittel- und langfristige Entwicklung von Jugendkriminalität bestätigen keineswegs zwingend die These einer kontinuierlichen und dramatischen Zunahme von Jugendkriminalität. Durch differenzierte Betrachtungen und Analysen von Kriminalitätsstatistiken sollen hier einige Trends deutlich gemacht werden (Heinz, 2003, S. 38):
Die Tatverdächtigenbelastungsziffer (TVBZ) erfasst die Tatverdächtigen auf 100 Tsd. der jeweiligen Bevölkerungsgruppe. Bis Mitte der 80er Jahre lag die TVBZ bundesweit bei Jugendlichen und Heranwachsenden bei Straftaten (ohne Vergehen im Straßenverkehr) relativ konstant. Seit Mitte der 90er Jahre ist die TVBZ insgesamt und somit auch bei Kindern und Jugendlichen erheblich gestiegen. Im Jahre 2001 lag sie mit dem Wert von ca. 10.000 (10%) Tatverdächtigen bei Jugendlichen um 83 Prozent und bei Heranwachsenden um 63 Prozent höher als 1984.
Nach Angaben des Bundeskriminalamtes (PKS- Bericht, 2004) wurden im Jahre 2004 12,5 Prozent bzw. 10,5 Prozent der Straftaten von Jugendlichen und Heranwachsenden begangen, der Anteil von Kindern unter 14 Jahren lag bei 4,9 Prozent und erreichte somit einen annähernd gleichen Wert wie 1984. Der prozentuale Anteil der Tatverdächtigen in der Altersgruppe von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden ist demnach mit insgesamt ca. 30 Prozent und einem Bevölkerungsanteil dieser Altersgruppe von ca. 13 Prozent deutlich überrepräsentiert.
Die Verurteiltenbelastungsziffer (VBZ) erfasst die tatsächlich verurteilten Straftäter. Der Anstieg bei der VBZ lag 2001 im Vergleich zu 1984 bei nur 0,5 Prozent bei Jugendlichen und 20,8 Prozent bei Heranwachsenden. Die Entwicklung von TVBZ und VBZ sind jedoch deliktspezifisch unterschiedlich. So blieb die Verurteiltenziffer bei einfachem Diebstahl seit 1984 weitgehend konstant, bei schwerem Diebstahl war sie leicht rückläufig, bei Gewaltdelikten wie gefährlicher und schwerer Körperverletzung stieg sie seit 1990 erheblich an (Heinz, 2003, S. 38 ff).
Die Untersuchungsergebnisse lassen somit auf einen stetigen Anstieg von Delinquenz in Form aggressiven Verhaltens schließen. Den höchsten Anteil an der TVBZ der 14 bis 18jährigen sowie bei Kindern unter 14 Jahren hat der Auswertung der Kriminalitätsstatistiken zufolge einfacher Diebstahl ohne erschwerende Umstände.
Im Hinblick auf geschlechtsspezifische Differenzierungen ergeben sich erhebliche Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. 2004 waren 76 Prozent der Verdächtigten männlichen Geschlechts. Lediglich 14,3 Prozent der verurteilten Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren waren Mädchen. Zu den von Mädchen häufiger begangenen Straftaten zählt neben Eigentumsdelikten die Prostitution, bei Jungen ergibt sich eine höhere Gewaltkriminalität (PKS 2004). Es sei an dieser Stelle aber auch darauf hingewiesen, dass mehr als die Hälfte der jugendlichen Straftaten von einem kleinen Kreis (6%) von Wiederholungstätern begangen wird.
4.2 Aggressivität
4.2.1 Individuelle Risikofaktoren
Ähnlich wie bei den Ausführungen zu Bedingungskonstellationen der Störungen des Sozialverhaltens (Kap. 4.1.1.) lassen sich auch hier biologische Risikofaktoren vermuten, wenngleich diese bislang nur unzureichend erforscht wurden. So ist bspw. unklar, ob die häufige Korrelation von elterlichen mit kindlichen Aggressionsstörungen hauptsächlich auf das Prinzip des Modellernens zurückzuführen oder aber mit einer vererbbaren genetischen Prädisposition in Verbindung zu bringen ist (Petermann & Wiedebusch, 1999, 331).
Bezüglich individueller Voraussetzungen besteht jedoch Grund zur Annahme, dass die Missinterpretation persönlicher Absichten anderer (feindlicher Attributionsstil, vgl. Kap. 4.3.1) aufgrund sozialer Wahrnehmungsstörungen zustande kommt (Hartung, 2001, S. 310). Denn aggressive Kinder und Jugendliche zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie generell Schwierigkeiten haben, Mimik und Gestik anderer adäquat zu deuten (Petermann & Wiedebusch, 1999, S. 336). Daraus folgt, dass besonders missverständliche soziale Situationen und konfliktträchtige Momente zu unreflektierten Reaktionen und somit zu eskalierenden aggressiven Verhaltensweisen führen können (ebd., S. 334).
Es wurde darüber hinaus festgestellt, dass aggressive Kinder und Jugendliche ein verhältnismäßig geringes Selbstwertgefühl haben. Dies lässt den Rückschluss zu, dass eine aggressive Verhaltensweise als inadäquater Versuch gewertet werden kann, das geringe Selbstwertgefühl zu kompensieren oder sogar durch ein positives Selbstkonzept zu ersetzen (ebd.).
Der Mangel an Empathie ist ein weiterer Faktor, der zu aggressiven Verhaltensweisen prädisponiert. Die tendenzielle Unfähigkeit zur Perspektivenübernahme wirkt sich nämlich insofern negativ aus, als sie ein empathisches Einfühlen in das Erleben anderer Personen verhindert. Somit sind aggressive Kinder und Jugendliche nur stark bedingt in der Lage, sich in die Situation ihrer Opfer hineinzuversetzen und Mitleid zu empfinden (ebd., S. 335).
Eine Ursache für aggressive Verhaltensweisen wird auch in dem Mangel an sozialer Kompetenz und dem Fehlen eines prosozialen Verhaltensrepertoires gesehen (Hartung, 2001, S. 309). Das Verhalten aggressiver Kinder ist bspw. dadurch gekennzeichnet, dass sie sich an gemeinsamen spielerischen Aktivitäten seltener beteiligen als ihre unauffälligen Gleichaltrigen. Daraus ergibt sich, dass eine nicht-aggressive Interaktion mit dem sozialen Umfeld erschwert und vermehrt auf aggressive Formen der Kommunikation zurückgegriffen wird (Petermann & Wiedebusch, 1999, S. 335).
4.2.2 Familiäre Risikofaktoren
Das Auftreten aggressiver Verhaltensstörungen wird im familiären Rahmen durch eine Vielzahl von Faktoren begünstigt, die zu einer Eskalation der Problematik beitragen können. So gilt z.B. ein Erziehungsverhalten, dass durch unangemessene Strenge – bspw. in Form körperlicher Züchtigung – gekennzeichnet ist, als riskant (Hartung, 2001, S. 310). Es wird in diesem Zusammenhang davon ausgegangen, dass eben aufgrund dieses angewandten Erziehungsstils aggressive Verhaltensweisen vom Kind oder Jugendlichen angeeignet und beibehalten werden. Somit kann Aggressivität im familiären Kontext erlernt werden, was dem Prinzip des Modellernens entspricht. Das unangemessene Verhalten der Eltern oder eines Elternteils wird vom Kind oder Jugendlichen als Verhaltensvorbild interpretiert (Petermann & Wiedebusch, 1999, S. 331).
In diesem Fall kann das Kind auch auf verhängnisvolle Weise erfahren, dass seine Eltern in der Ausübung von Gewalt ihm gegenüber ein scheinbar adäquates Mittel zur Erreichung ihrer Ziele finden und wendet folglich dieses Verhalten in möglichen Konfliktsituationen selbst an. Diese Art von Erziehungsverhalten beinhaltet demnach auch die Gefahr des instrumentellen Konditionierens, also des Lernens am Erfolg. Dies bedeutet, dass Aggressivität zum einen dadurch positiv verstärkt wird, dass gewünschte Umstände eher eintreten als ohne Anwendung aggressiven Verhaltens. Zu anderen spricht man von einer negativen Verstärkung, wenn als unangenehm empfundene Situationen oder Momente durch aggressive Handlungsweisen minimiert werden können (Hartung, 2001, S. 309).
Darüber hinaus ist es auch als ungünstig zu werten, wenn das Kind oder der Jugendliche mit seinem aggressiven Verhalten seitens der Eltern eine Duldung erfährt, denn diese kann so zu sagen als stillschweigende Zustimmung zu seinem unangemessenen Verhalten verstanden werden (ebd., S. 310).
Das Prinzip der Verstärkung kann sich auch in einem wechselseitigen Verhältnis auswirken: So provoziert aggressives Verhalten seitens des Kindes oder Jugendlichen einen unangemessenen Erziehungsstil der Eltern, der wiederum zum problematischen Verhalten des Kindes führt. Man kann diesbezüglich also von einem Aufschaukelungsprozess sprechen, der die ohnehin schon kritische Situation potenziell fortwährend eskalieren lässt (Petermann & Wiedebusch, 1999, S. 332).
Zudem gelten im Rahmen des Erziehungsverhaltens ein inkonsequenter Umgang mit Regeln, eine mangelnde Kontrolle der Regeleinhaltung und eine mangelhafte Wahrnehmung und Verstärkung prosozialer Verhaltensweisen als prädisponierende Faktoren für das Auftreten einer aggressiven Verhaltensstörung (Hartung, 2001, S. 310).
4.2.3 Risikofaktoren der sozialen Umwelt
Für das Zustandekommen einer aggressiven Verhaltensstörung gelten neben den individuellen und familiären Voraussetzungen die Bedingungen der sozialen Umwelt als bedeutsam. Einen Hinweis hierfür liefert die Tatsache, dass aggressives Verhalten in den unteren sozialen Schichten öfters festzustellen ist als in den Mittel- und Oberschichten und zwar unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Bevölkerungsgruppe (Steinhausen, 2002, S. 216). So gesehen kann die Zugehörigkeit zu sozial schwachen Bevölkerungsgruppen potentiell zu aggressiven Verhaltensstörungen prädisponieren, vor allem dann, wenn andere ungünstige Faktoren sich wechselseitig verstärken. Folglich werden z.B. eine sozioökonomische Belastung der Familie und Misserfolge in Schule, Ausbildung und Beruf bei gemeinsamem Auftreten als begünstigende Umstände betrachtet (Hartung, 2001, S. 310).
Darüber hinaus führen die im sozialen Umfeld vorhandenen aggressiven Modelle (bspw. in der Schule oder in den Medien) dazu, dass das Kind oder der Jugendliche sich dieses Verhalten aneignet. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die unmittelbare Umwelt insofern reagiert, als sie dem Aggressor (bspw. durch Duldung) signalisiert, dass besagtes Verhalten zur Durchsetzung eigener Ziele legitim erscheint und soziale Anerkennung zur Folge hat (ebd., S. 309).
In diesem Zusammenhang spielen positive und negative Verstärkung (wie bereits in Kap. 4.2.2. dargestellt) ebenso eine bedeutende Rolle. Wenn aggressive Handlungsweisen sich zur Durchsetzung bestimmter Ziele als erfolgreich erweisen, also positiv verstärkt werden, spricht man auch von instrumenteller Aggression. Dem gegenüber steht die so genannte angstmotivierte Aggression, die mit der negativen Verstärkung korrespondiert (Petermann & Wiedebusch, 1999, S. 336).
Die Reaktionen der Umwelt auf das aggressive Verhalten des Kindes oder Jugendlichen sind oftmals von Zurückweisung und Isolation gekennzeichnet, da das unmittelbare soziale Umfeld mit der Problematik nicht anders umzugehen weiß. Aufgrund der daraus resultierenden Unfähigkeit, sich in eine (nicht-aggressive) soziale Bezugsgruppe zu integrieren, findet der Aggressor möglicherweise Anschluss in einer ebenfalls durch aggressive Verhaltensweisen charakterisierten Gruppe. Diese akzeptiert sein Verhalten, wodurch es weiterhin positiv verstärkt wird.
.
.
Ein Migrationshintergrund erweist sich demnach nur in der entsprechenden Bedingungskonstellation als Risikofaktor (jedoch führt ein Migrationshintergrund recht häufig zu genau dieser Bedingungskonstellation) In Untersuchungen wurde festgestellt, dass bei vergleichbaren Bedingungskonstellationen die Prävalenzrate von Delinquenz, Aggressivität etc. bei deutschen Jugendlichen noch geringfügig höher liegt als bei ausländischen Jugendlichen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
tai