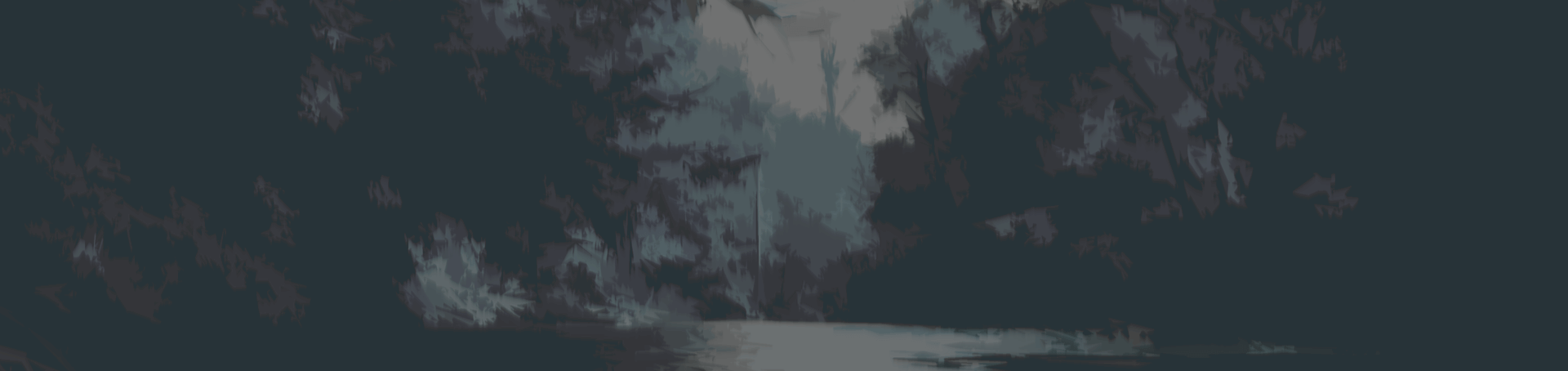Hier ein m. E. sehr lesenswerter und gleichwohl provokativer Beitrag von Matthias Heitmann, in dem die Absurdität der gängigen Anti-Doping-Argumente bestens aufgezeigt wird:
"Doping freigeben! oder: Pimp my Leistungsdenken"
Der Kampf gegen Doping richtet sich nicht gegen den Einsatz „verbotener“ Substanzen, er ist vielmehr ein moralischer Kreuzzug gegen menschliches Leistungsstreben im Allgemeinen.
Man stelle sich folgendes Szenario vor: Im Oktober 2007 ergeben Kontrollen der Ausrüstung der Fußballer des FC Bayern München, dass die Stollen an bajuwarischen Kickstiefeln zwei Millimeter länger sind als zulässig. Diese Abweichung wird dafür verantwortlich gemacht, dass die Spieler auf morastigem Untergrund wesentlich besser Halt finden als die Konkurrenz. Diese Enthüllung ruft ARD und ZDF auf den Plan: Die „Sportschau“ wird bis auf Weiteres eingefroren, das altehrwürdige „Aktuelle Sportstudio“ wird zur fußballfreien Zone erklärt und zahlreiche Sponsoren ziehen sich wegen vorsätzlicher Wettbewerbsverzerrung aus dem Profigeschäft zurück. Unvorstellbar? Ja, zum Glück, möchte man meinen. Hat ja auch nichts mit Doping zu tun. Oder etwa doch?
Derzeit können wir bei der Tour de France ähnlich Unvorstellbares beobachten, weniger in Bezug auf das Handeln der Athleten, sondern eher, was die öffentlichen Debatte betrifft. Wie seit Jahrzehnten versuchen Sportler, mit allen erlaubten (und ja: auch unerlaubten) Tricks, ihr Leistungsvermögen zu steigern. Der Umfang, in dem dies geschieht, hat in der Masse nicht zugenommen. Warum also nehmen ARD und ZDF den auf Anfang Juni datierten Doping-Verstoß eines bereits verletzt ausgeschiedenen deutschen Radfahrers zum Anlass, ihre Übertragungen der Tour de France einzustellen?
Die uns dafür gebotenen Erklärungen greifen zu kurz. Wären Regelverstöße von Athleten ein hinreichender Grund, einen Sport zu ächten, so gäbe es keinen Sport. Regelverstöße sind im Sport an der Tagesordnung. Sie resultieren aus dem Streben, die bestmögliche Leistung zu erzielen, zuweilen schießt man hier über das Ziel und den Rahmen des Erlaubten hinaus. In Sportarten, in denen das Sportgerät eine entscheidende Rolle spielt, umfasst dieser Rahmen des Erlaubten natürlich auch die Beschaffenheit dieser Hilfsmittel. In der Formel Eins, deren Verlauf nur bis zu einem gewissen Grad von der Pilotenleistung entschieden wird, macht derjenige am Ende das Rennen, der zusätzlich auch über das beste Gefährt und das leistungsfähigste Team verfügt. Die Zeit zwischen den Rennen wird dazu genutzt, das Beste aus den Maschinen herauszuholen. Das Prinzip „Pimp my ride“ wurde hier erfunden.
Gerne erinnern wir uns auch an die Live-Übertragungen vom Rennrodeln und die Interviews mit der deutschen Rodel-Ikone Georg Hackl, in denen er davon berichtete, die ganze Nacht über in seiner Werkstatt an seinem Gefährt herumgefeilt zu haben, um es optimal auf das Rennen vorzubereiten. Ein Grund, dem Fernsehvolk diesen Sport vorzuenthalten, ist dies nicht. Beim Skispringen zählen neben dem Geschick und dem Gewicht des Athleten vor allen Dingen die Flugeigenschaften des Skianzugs. Dass man Skispringern Vorschriften macht, wie wenig oder viel der Anzug wiegen kann und dass das Anbringen von Raketenantrieben nicht gestattet ist, leuchtet ein. Auch, dass es Vorschriften über die Beschaffenheit von Formel-Eins-Fahrzeugen und Rennschlitten gibt, macht Sinn. Das Einhalten von derlei Vorschriften ist auch recht einfach sicherzustellen. Eher amüsiert wären wir hingegen zu erfahren, dass Kugelstoßer nächtelang ihr Sportgerät pflegen, damit es am nächsten Tag möglichst weit fliegt.
„Pimp my ride“: hui – „pimp my body“: pfui?
Problematisch wird ein solches Kontrollregime jedoch, wenn es nicht um das Sportgerät, sondern um den Körper des Sportlers geht. Sportgeräte können leicht als unzulässig entlarvt werden: zu leicht, zu schwer, zu klein, zu groß, unzulässige Technik, zusätzliche oder fehlende Komponenten und Eigenschaften – all das ist bestimm- und messbar. Bei einem Boxer gibt es zwar auch Grenzwerte dafür, wie schwer oder leicht er in einer bestimmten Gewichtsklasse sein darf – wie stark er aber zuschlagen können oder wie breit sein Bizeps sein darf, ist nicht geregelt. Im Sprint können Läufer, die zu schnell laufen, nicht disqualifiziert werden. Hier wird der Unterschied zwischen Athlet und Athletenausrüstung deutlich: Die Ausrüstung ist ein Hilfsmittel, deren Beschaffenheit den sportlichen Vorschriften zu entsprechen hat, um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Fairer Wettbewerb bedeutet: Entscheidend soll die tatsächliche athletische Leistung des Einzelnen sein. Es soll einzig um Körper- und Willenskraft, um Geschick, Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit gehen – mithin um das Messen der „ureigensten Kräfte“ von Menschen.
An diesem Punkt setzt der Kampf gegen das Doping an. Er hat sich zum Ziel gesetzt, den Sport „sauber“ und „fair“ zu halten, damit ausschließlich eben diese ureigensten Kräfte von Athleten den Ausschlag über Erfolg und Misserfolg geben. Zwar wird nicht davon ausgegangen, dass die Fähigkeiten des Menschen natürlich begrenzt seien, aber es wird angenommen, es gäbe unterschiedlich zu bewertende Mittel und Wege, um das Ziel, die Verbesserung der sportlichen Leistung, zu erreichen. Auch hier unterscheidet sich die Dopingkontrolle grundlegend von der Zulässigkeitskontrolle von Sportgeräten, denn: WIE ein Sportgerät bearbeitet wurde, um den Bestimmungen zu genügen, interessiert nicht, es zählt einzig das messbare Ergebnis. Beim Doping ist es gerade umgekehrt: Nicht das Resultat der Behandlung – eine bestimmte Leistung – wird einer Bewertung zugeführt, sondern der WEG dorthin. Entscheidend ist nicht, wie stark die Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff zu binden, verbessert wurde, sondern, ob dies über „legales“ Höhentraining oder „illegale“ Methoden wie z.B. Eigenblut-Behandlungen erreicht wurde.
Als zulässig gilt es, professionell Sport zu betreiben, täglich hart zu trainieren und sein Leben einseitig auf den Sport auszurichten. Der Einsatz von Maschinen, Trainingsmethoden und besonderer auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte Nahrung ist zulässig und Gang und Gäbe. Diese Spezialisierung kann ungehindert und so weit getrieben werden, dass der Sportler seinen Körper regelrecht „verbraucht“ und zum Wrack macht – vor den Augen der begeisterten Öffentlichkeit, die die Sportler zurecht als Helden feiert. Die Gesellschaft achtet ein solches Vorgehen; Sportinvalidität ist kein sozialer Makel, und Weltmeister sind unsterblich.
Doping ist .... verboten!
Vordergründig richtet sich der Kampf gegen Doping also gegen unlautere Mittel und Methoden zur Leistungssteigerung, nicht gegen die Leistungssteigerung als solche. Doch was so klar und einfach erscheint, ist es in der Praxis nicht. Die Probleme zeigen sich am deutlichsten bei der grundsätzlichsten aller eine solche Thematik eigentlich begründeten Übungen: der Definition des als verwerflich geltenden Tatbestandes. Im sogenannten olympischen Antidoping-Code aus dem Jahre 2000 wird dieser Tatbestand definiert als „die Verwendung von Hilfsmitteln in Form von Substanzen und Methoden, welche potentiell gesundheitsschädigend sind und/oder die körperliche Leistungsfähigkeit steigern können“, aber auch als „das Vorhandensein einer verbotenen Substanz im Körper einer Sportlerin oder eines Sportlers oder die Bestätigung deren Verwendung oder der Verwendung einer verbotenen Methode”.
Dass diese „Definition“ nicht weit führt, ist offensichtlich: Leistungssportler tun vorsätzlich viele ungesunde, aber leistungssteigernde Dinge, ohne damit unter Dopingverdacht zu geraten. Dass hier die Gesundheit des Athleten als Kriterium für „legales Sportlerverhalten“ herangezogen wird, ist realitätsfremd und auch falsch. Kaum jemand würde ernsthaft behaupten wollen, dass Leistungssport betrieben wird, um gesund zu bleiben. Das Gegenteil ist der Fall: Die Gesundheit ist dem Leistungssportler kein Wert an sich, sondern, wenn überhaupt, nur Mittel zum Zweck. Der zweite Teil der Definition offenbart endgültig die inhaltliche Leere des „Konstruktes Doping“: Er besagt nichts anderes, als dass Doping all das sei, was als verboten gelte. Mit einer solchen Legitimation kann sich ein aufgeklärter Bürger (und Sportler) nicht abfinden. Regeln müssen nachvollziehbar sein, um nicht willkürlich zu sein.
Auch das seit 2004 in Deutschland geltende Anti-Doping-Regelwerk der Nationalen Anti Doping-Agentur (NADA), das auf dem Code der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) basiert, kann den Tatbestand, dem sie ihre Existenz und ihren Namen verdankt, nicht eindeutig definieren. So heißt es hier: „Doping wird definiert als das Vorliegen eines oder mehrerer der nachfolgend (...) festgelegten Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen.“ In den nachfolgenden Festlegungen dreht sich alles um als verboten geltende Substanzen und Methoden, gesammelt auf der mindestens einmal jährlich veröffentlichten Liste verbotener Wirkstoffe und verbotener Methoden, sowie um deren rechtmäßige Kontrolle. Nach welchen Kriterien Substanzen und Methoden jedoch als unzulässig eingestuft werden, bleibt unklar. Dass etwas verboten sei, kann nicht als Begründung eines Verbotes gelten.
Durch die Definition über den Umweg einer „Positivliste“ ist Doping zudem nicht nur ein sich stetig wandelndes Konstrukt ohne konkrete Gestalt, sondern auch eines ohne jeglichen moralischen Bindungscharakter. Ein solcher könnte nur entstehen, wenn eindeutig klar wäre, welche konkreten Eigenschaften eine Substanz oder eine Methode zu einer verbotenen machen. Die Unklarheit des Dopingsbegriffs liegt somit in der Natur der Sache, denn die zentralen Fragen, auf denen die moralische Verurteilung von Doping basiert, können nicht eindeutig beantwortet werden.
Das Problem der Doping-Debatte besteht nicht, wie viele meinen, darin, dass die Verwendung verbotener Substanzen und Methoden an sich nicht nachweisbar sei – sie ist sogar immer besser nachweisbar, wie die jüngsten Ereignisse zeigen. Das Problem ist, dass es keine stichhaltige Definition dessen gibt, was Doping eigentlich ist und warum. Hierdurch wird die Doping-Debatte zu einer rein moralischen, die den Athleten zum bloßen Werkzeug einer vermeintlich wertorientierten Grundhaltung degradiert.
Welche Leistungen sind „natürlich“?
Eine zentrale Prämisse für die vehemente Ächtung von Doping ist die Vorstellung, hierdurch würde die Leistungsfähigkeit von Sportlern auf unnatürliche Weise erhöht. Doch obwohl diese Prämisse zumeist nicht hinterfragt wird, ist sie nicht haltbar: Welche Leistungen des Menschen sind schon natürlich? Ist es natürlich, dass wir Sport betreiben, schnell laufen, Metallkugeln oder Speere in rücken- und schulterschädigender Weise werfen oder uns Eiskanäle auf Schlitten hinunterstürzen? Ist es natürlich, Teile unserer Körper so einseitig auszutrainieren, dass wir zwar im Marathon zu Höchstleistungen in der Lage sind, uns aber beinahe jede Fähigkeit zum Gewichtheben abgeht? Ist unser Leben überhaupt natürlich?
Die Antwort ist eindeutig: Wir leben gänzlich unnatürlich. Unser ganzes Leben, unsere Zivilisation sowie unsere Ziele und Hoffnungen basieren auf der permanenten Überschreitung als natürlich geltender Grenzen. Wir wollen älter werden als 36 Jahre, wir wollen im Winter nicht erfrieren oder von simpelsten Krankheiten dahin gerafft werden, und wir wollen unser Dasein nicht wie unsere Vorfahren als Jäger und Sammler fristen. Es ist genau diese Abgrenzung von der Natur, die den Menschen menschlich macht. Menschlichkeit bedeutet: sich nicht den Naturgesetzen unterwerfen, sondern Freiräume erkämpfen, Potenziale erschließen und zu einer Verbesserung des Lebens nutzen. Jeder zivilisatorische Fortschritt basiert auf diesem Streben.
So hat der Mensch nicht nur die Welt verändert, sondern auch sich selbst: Er wird größer und älter als jemals zuvor, er lebt gesünder als jemals zuvor, er hat physische Fähigkeiten entwickelt, die er früher nicht hatte, er hat seinen eigenen Körper umgestaltet – selbst wenn wir in einigen Bereichen körperlich unseren gesellschaftlichen Entwicklungen hinterherhinken. Doch auch dieses Problem löst der Mensch, seit er existiert. Die Verwendung von Werkzeugen, so primitiv sie auch sein mögen, liegt in der Erkenntnis begründet, dass wir unsere physischen Begrenztheiten überwinden können. Mit dem Einsatz des Faustkeils konnten die Menschen Kräfte mobilisieren, die ihre eigentlichen Fähigkeiten bei Weitem überstiegen. Das Rad, der Hebel – allesamt Produkte des stärksten menschlichen Muskels: des Verstandes – lassen uns Taten vollbringen, für die wir rein körperlich nicht vorgesehen sind. Mithilfe von Pflanzen begannen die Menschen schon sehr früh, sich zu „dopen“ – noch heute schätzen wir Heilkräuter wegen ihrer positiven und lebensverlängernden Wirkung. Neben Pflanzen züchten und verändern wir auch Tiere, um sie besser verträglich zu machen.
Diese gesellschaftliche Entwicklung hat es überhaupt erst ermöglicht, dass sich Menschen heute bestimmten Tätigkeiten widmen können: Kultur, Kunst, Sport, Wissenschaften – all dies wäre ohne das Abstreifen der Fesseln der Natur und ohne die Überwindung unserer archaischen Lebensweise unvorstellbar. Insofern ist die Vorstellung, dass ausgerechnet im Leistungssport – einer per se kulturellen und damit zutiefst künstlichen Erscheinung – plötzlich „natürliche“ Leistungsfähigkeit ausschlaggebend für seinen kulturellen Wert sein solle, zutiefst widersinnig. Mehr noch: Sie untergräbt gerade die entscheidenden Merkmale menschlicher Zivilisation und führt sie ad absurdum. Zivilisation daran zu messen und zu bewerten, ob sie natürlich sei, heißt: ihre Errungenschaften abwickeln.
Übertragen auf das Kulturphänomen Leistungssport bedeutet dies: Die Messlatte der Natürlichkeit kann nicht übersprungen werden. Natürlicher Sport ist: kein Sport. Leistungssport ist per definitionem unnatürlich, da sowohl der menschliche Leistungsbegriff als auch Sport an und für sich in der Natur keinen Platz haben. Natur „leistet“ nichts, und sie ist auch nicht „sportlich“. Eine logische Unterscheidung von leistungssteigernden Substanzen und Methoden in „natürliche“ und unnatürliche“ ist mithin unmöglich. Oder anders formuliert: Wer diese Unterscheidung dennoch aufrecht erhält, verwehrt sich der Einsicht, dass es gerade die einmalige Leistung des Menschen ist, kein „natürliches Leben“ zu führen, sondern beständig die Grenzen des Möglichen weiter hinauszuschieben. Wer diese Unterscheidung dennoch aufrecht erhält, muss sich vorhalten lassen, menschliche Leistung an und für sich zu negieren und im Leistungsstreben des Menschen nicht den Schlüssel zu seinem Erfolg, sondern den Weg in seinen Untergang zu sehen – eine zutiefst antihumanistische Anschauung.
Fairness hat mit Gleichheit nichts zu tun
Als weiteres Argument gegen den Einsatz bestimmter leistungssteigernder Präparate wird angeführt, dies widerspräche allen Regeln sportlicher Fairness. Diese sei nur dann gewährleistet, wenn alle Sportler dieselben Voraussetzungen hätten. Auch dieses Argument klingt zunächst einleuchtend. Dennoch beweist jeder sportliche Wettbewerb, dass Sportler keineswegs die selben Voraussetzungen haben. Das Prinzip des Leistungssports ist es, die Voraussetzungen des Leistungssportlers permanent zu optimieren und die so entstehenden Vorteile gegenüber seinen Kollegen zu nutzen. Dass deutsche Olympioniken in der Regel mehr Medaillen nach Hause bringen als ihre Sportskameraden aus Bangladesh, hat gesellschaftliche Gründe. Unsere Gesellschaft ist wohlhabender und kann und will sich Leistungssport leisten. Der Länderwettstreit ist – und so wird er auch in der Öffentlichkeit betrachtet – ein Wettstreit zwischen verschiedenen Gesellschaften und somit auch Leistungssportsystemen, er ist Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse. Diese sind nicht gleich. Und dennoch ist der Wettstreit zwischen ihnen „fair“: Sportler aus Deutschland haben sich denselben Wettkampfregeln und -bedingungen unterzuordnen wie Sportler aus Bangladesh.
Fairness hat mit Gleichheit nichts zu tun. Wären Sportler alle gleich, würde ein Wettstreit keinen Sinn machen. Er macht aber dann Sinn, wenn sich ungleiche Sportler in einem fairen Wettbewerb miteinander messen. Fairness beschreibt einen gleichberechtigten Umgang zwischen gänzlich verschiedenen Menschen, ist also eine Frage des Verhaltens und nicht der Leistungsfähigkeit. Es ist auch nicht „unfair“, dass FC Bayern München zumeist gegen unterklassige Mannschaften gewinnt.
Ungleichheit ist gesellschaftlich und kulturell begründet, aber nicht nur: Afrikanische Langstreckenläufer dominieren ihre Disziplin, nicht, weil sie im Wettbewerb unfair behandelt würden, sondern weil sie ein anderes Leistungsvermögen abrufen können. Dass Japaner im Hochsprung keine Weltmacht sind, hat nicht nur kulturelle Gründe – sie sind im Durchschnitt schlichtweg kleiner als Athleten aus Hochsprungnationen. Ist es deshalb „unfair“, dass Japaner keine Hochsprungmedaillen einfahren? Nein. Wer Gleichheit mit Fairness verwechselt, läuft Gefahr, durch zwanghafte Gleichmacherei nicht nur die Basis für sportlichen Wettkampf, sondern auch für gesellschaftlichen Fortschritt im Allgemeinen zu untergraben.
Fazit
Die Doping-Debatte wird auf der Basis von einer Reihe überaus fragwürdiger moralischer Vorstellungen geführt, die nicht nur für den Sport, sondern auch für die Entwicklung unserer Gesellschaft überaus problematisch sind. Leistungssport ist per se eine unnatürliche, weil kulturell geprägte, zivilisatorisch begründete und mithin künstliche, aber gerade deswegen für den Menschen so typische Betätigung. Daher sind auch Leistungssteigerungen grundsätzlich „unnatürlich“, wie auch der Leistungs- und Fortschrittsbegriff künstlich, weil menschgemacht ist. Die Vehemenz, mit der die Frage künstlicher Leistungssteigerungen debattiert wird, ist nicht über bloße Aufregung angesichts von „Regelverstößen“ zu erklären. Viel mehr bricht sich hier ein sehr grundsätzliches Unbehagen gegenüber der Unnatürlichkeit unseres modernen Lebens Bahn. Die Abkehr von natürlichen Lebensweisen sowie das Überschreiten natürlicher Grenzen wird in einer Zeit, in der die Menschen sich selbst und ihrer Gattung misstrauisch gegenüberstehen, sehr häufig als Ursache für zahlreiche gesellschaftliche Missstände angesehen. Dieses Misstrauen in unsere Fähigkeiten und Leistungen sowie die Angst vor Veränderungen und Weiterentwicklungen lähmt uns. Die vermeintliche Vision eines natürlicheren Lebens ist keine Strategie zur Lösung von Problemen, sondern eine Rückzugsstrategie. Dagegen wäre die Freigabe von Doping ein positives Signal – ein Beleg dafür, dass man den Menschen und Gesellschaft zutraut, mit Freiheiten umgehen zu lernen und sich positiv entwickeln zu können. Ohne dieses Vertrauen machen Freiheiten, aber auch Appelle an Fairness und Sportlichkeit keinen Sinn.
Quelle:
Matthias Heitmann Klartext | "Doping freigeben! oder: Pimp my Leistungsdenken"