Ich habe nichts gegen hitzige Debatten wie diese hier, im Gegenteil.
Und wer austeilt muss auch einstecken können. Trotzdem bitte ich darum, dabei nicht allzu persönlich zu werden und ein Mindestmaß an Gesprächsniveau zu wahren.
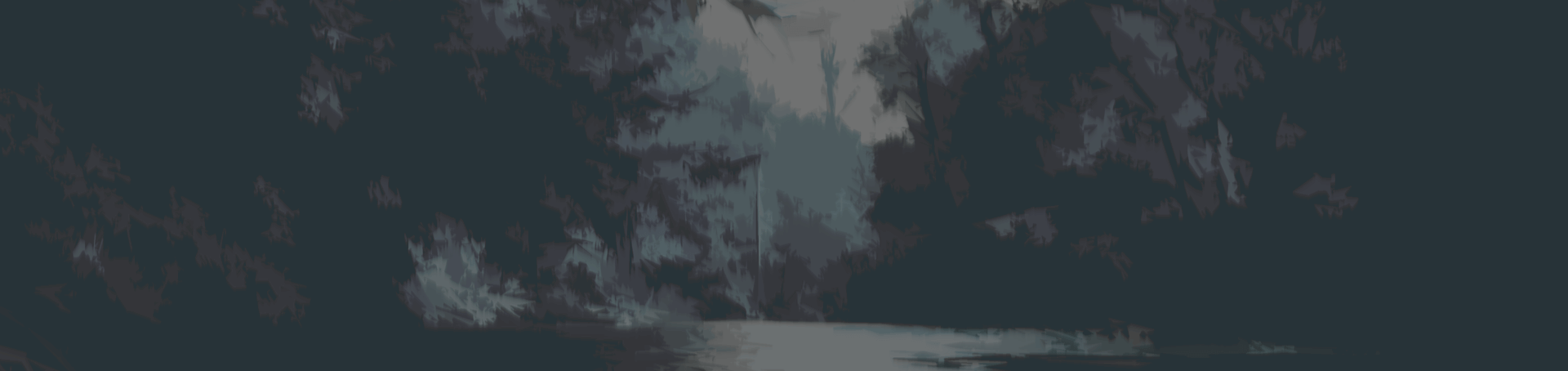
GastRoland hat geschrieben:Genau _das_ vermisse ich bei dir. Immer wieder.
Diese Aussage hat mir letztendlich einen heftigen Lacher entlockt. Danke dafür!
Den Hintergrund kennen nur "altgediente" Foris hier.
Roland
*ohne automatische Grußsignatur*
Abitany hat geschrieben:Es ist ein uferloses Thema ... zu umfangreich, um es hier in epischer Breite zu diskutieren ... nur ganz kurze Stichworte, die mir spontan kommen:
Asse: Lager für Material aus A-Forschung, unter staatlicher Führung, keine Atomindustrie
aber für die Atomindustrie, für Atomstrom
Stillgelegte A-Werke: Kosten trägt Industrie, nicht Steuerzahler
Habe da eine Studie aus den 80igern noch vor Augen, da wurden erheblich Teile von Steuergeldern bezahlt bei etwa 10-12 stillgelegten, die habe ich sogar noch irgendwo
Rückbau: nicht Steuerzahler, sondern Rücklagen des Betreibers, Atomgesetz
das könnte sein
Tschernobyl: auf unsere Kernkraftwerke technisch nicht übertragbar, dann schon eher Harrisburg
Neuer Sarkophag für Tschernobyl 2008 auch aus Steuergeldern der EU
Endlager: es müsste nur endlich in die Hand genommen werden
Ja wohin denn mit dem immer mehr werdenden Atommüll?
Vielleicht haben sie auch Angst vor den Kosten
A-Subventionen: genau das gleiche findet jetzt bei regenerativen Energien statt, und wird auch nicht in den Endpreis gerechnet ... auch nicht mögliche Folgen.
von Subventionen sprach ich nicht^
Rückstände: wie kommst du darauf, dass das nicht vom Betreiber bezahlt werden muss? Was glaubst du, wer die Zwischenlager, die Castor-Behälter und das drumherum bezahlt?
Mich würde es nicht wundern das auch da jede menge Steuergelder drauf gehen kenne die Vertragswerke nicht
Atomstrom war damals politisch gewollt, und über staatliche Anteile an den Energieunternehmen wurden manche sogar genötigt, Kernkraftwerke zu bauen, obwohl die nicht wollten ... hat man alles vergessen. Ebenso, dass es schon lange ein Endlager geben sollte.
Die armen reichen Konzerne wurden genötigt. Da müßten sie ja nun dem Staat richtig dankbar sein für ihren ungeahnten Reichtum.
Warum gibt es denn kein Endlager?
Spitzenforscher hielten ja Asse für ganz gut.
Gruß,
Achim
Wieso ?Siegfried hat geschrieben:atomkraft - Google-Suche
Hier hast Du noch mehr Material zum Reinkopieren - sag bescheid wenn Du fertig bist.
Übrigens - das ist ein Forum und kein Atommüll-Endlager
Siegfried
Was die Risiken angeht, ist es sowieso eine irrationale Diskussion.Bio Runner hat geschrieben:Die Atomkraftwerke laufen mit Sondergenehmigung da es kein Endlager gibt, schon ziemlich lange.
Sorry, ich kann mich nicht mit der Atomenergie, ihren Risiken und ihren Kosten anfreunden.
Gruß Rolf
Bevor jetzt der Körnermampfer wieder mit Subventionen kommt:Abitany hat geschrieben: Und die Kosten ... wenn ich an die Subventionen für die Kohle und regenerative Energien denke ... wieviel wir für fossile Brennstoffe ausgeben ... ob die für Kernenergie wirklich höher sind, ist zweifelhaft.
Sorry ... aber das ist kein guter Stil ... nur herabsetzend. Schade, dass du so jede Diskussion vergiftest.DanielaN hat geschrieben: ...Bevor jetzt der Körnermampfer wieder mit Subventionen kommt ...
hör mal auf, andere themen mit deinen wahnvorstellungen vollzumüllen!bamf hat geschrieben:Bin ich eigentlich der einzige der sich wundert, dass sich RPP*, einen Tag nach dem PR** gesperrt wurde, hier angemeldet hat? Abgesehen davon, dass sich ihre Beiträge in ihrer Art imo ähnlich sind, ebenso wie die Namen (RuPo/PoRu)?
Ontopic: Das muss man doch echt nicht kommentieren...
Gutes Nächtle!
* Running Pommespanzer
** Power-Runner
aber mich darf man hier denunzieren oder wie? so geschehen in 2 unterschiedlichen postings oben! irgendwie habe ich den eindruck, dass hier mit 2erlei mass gemessen wird.Tim hat geschrieben:Hey, bitte nicht in diesem Ton und auf diesem Niveau.
Och komm schon! Du kannst dich doch wehren.Running Pommespanzer hat geschrieben:aber mich darf man hier denunzieren oder wie? so geschehen in 2 unterschiedlichen postings oben! irgendwie habe ich den eindruck, dass hier mit 2erlei mass gemessen wird.
messe.Running Pommespanzer hat geschrieben:2erlei mass
ja, sorry für die unterstellung. hatte mich nur mal ein bissi geärgert, wenn die leute persönlich werden. ich muss mal checken, ob man hier *plonken* kann.Tim hat geschrieben:Och komm schon! Du kannst dich doch wehren.
Auch wenn du einen anderen Eindruck hast: Ich kann dir versichern, dass ich hier nicht mit messe.
).
Die Super-Nanny nutzt in solchen Situationen die "Stille Treppe".Tim hat geschrieben: Wenn ich hier jedes unfreundliche Wort ahnden würde, wäre das Forum manchmal am brennen (besonders Freitags).
HendrikO hat geschrieben:Was sind das für Kernse, die da bei Antwort zwei gespalten werden?
Ja wo sind wir denn hier ?HendrikO hat geschrieben:Sollte man Zitate nicht entsprechend kennzeichnen und die Quelle ausweisen?
Hi,fürabetraber hat geschrieben:Tschau Daniela
Damit Du nicht mehr gar soviel arbeiten, lies kopieren, musst, geben wir doch allen Lesern den Link deiner Quelle (www.kernenergie.de) bekannt. Da kann sich dann jeder selber seine Meinung bilden und sich hier mit eigenen Worten äussern.
Ich unterstütze zur Zeit übrigens die Kernenergie, lebe, unbekümmert, 20 km von einem Meiler entfernt. Ich bin aber sofort dafür, die Kernenergie zu stoppen, wenn wir die Möglichkeit haben Energie resp. Strom vernünftiger, sprich ohne aktiven Müll, herzustellen.
Zur Zeit sollten wir uns aber alle darum kümmern, möglichst wenig zu verbrauchen und nicht nur auf der Suche nach immer mehr und grösseren Energiequellen sein. Stichwort: 2kW-Gesellschaft. Was hältst Du von diesem Denkansatz?
Grüsse
Daniela! HendrikO hat absolut recht! Zitieren nur mit Quellenangabe! Also bitte nachreichen.HendrikO hat geschrieben:Sollte man Zitate nicht entsprechend kennzeichnen und die Quelle ausweisen?
Lass sie doch, das ist so ne Art fanatischer Anfall, sie muß sich abreagieren.Gadelandrunner hat geschrieben:Hej, Daniela, mach ma Marathontraining, dann musst du nicht so viel schreiben!
Dat nervt viele
gadelandrunner
Bio Runner hat geschrieben:Lass sie doch, das ist so ne Art fanatischer Anfall, sie muß sich abreagieren.
wahrscheinlich konnte sie die Kritik nicht verarbeiten
oder aber sie bekommt etwas dafür wenn sie nun diese Kernenergie-website hier hinein kopiert
Gruß Rolf
WozuMoonraker hat geschrieben:Ein paar Physik-Vorlesungen (1.Semester) würden dir gut zu Gesicht stehen!!!!
Du machst hier herum wie eine Avon Beraterin mit Hochglanzbroschüre die ihre Produkte mit aller macht verkaufen will und dabei alles auf den Tisch legt was irgendwie Avon hervor hebtDanielaN hat geschrieben: Aber Null Antworten ..... ganz normal für Grüne und Linksparteiler.
DanielaN hat geschrieben:von CENAP Pro @ Freitag, 06. Feb, 2009 – 12:28:56
Die Geschichte eines UFO- Stimuli
Teil 2
Bio Runner hat geschrieben:


... wenn nicht sogar bereits transATPoideronnykind hat geschrieben:Jetzt nimmt der Faden ATPeske Züge an.