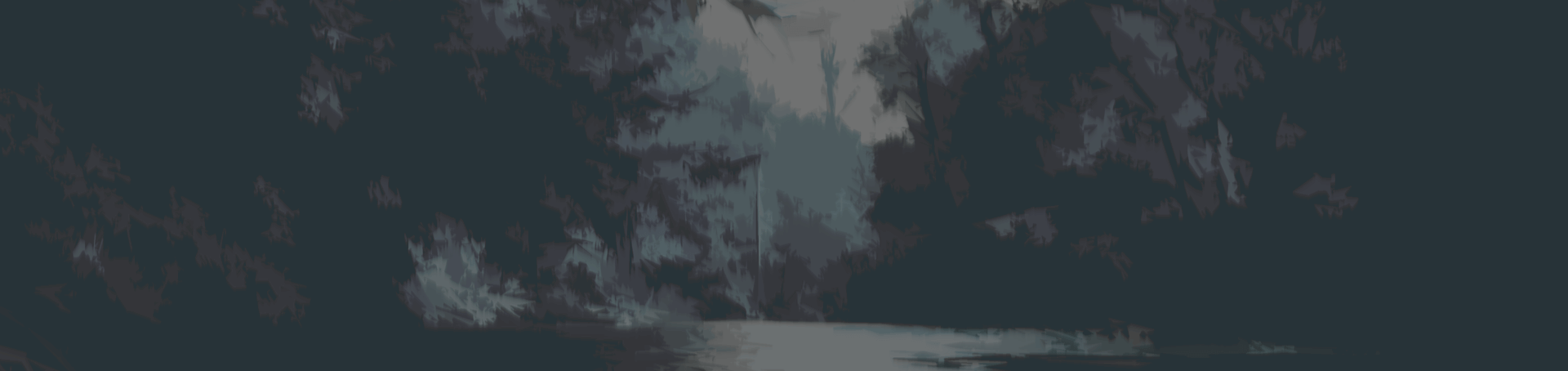Steffen42 hat geschrieben:Ich habe es immer noch nicht verstanden.
Gute Fragen und gar nicht so leicht zu beantworten. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen aufzuteilen nach den relevanten Aspekten.
Steffen42 hat geschrieben:Wer geht mit so entleerten Speichern an den Start, dass beim HM nachgefüllt werden muss?
Die Frage ist ja, wie sich der "Füllstand" der Glykogenspeicher auf die Leistung auswirkt. In anderen Worten: ist es egal, ob die Speicher zu 90% oder zu 10% gefüllt sind und es kommt erst zu einer Leistungseinbuße, wenn die Speicher leer sind? Oder handelt es sich hier vielmehr um einen graduellen Prozess, d.h. ab einem gewissen Punkt nimmt die Leistung immer mehr ab?
Die aktuellen Meinungen gehen ganz klar in die zweite Richtung, auch wenn der genaue Mechanismus nicht klar ist. Eine These ist, dass das Hirn als "Central Governor" registriert, dass die KH-Vorräte langsam zur Neigung gehen und anfängt die Leistung langsam (und bei immer leereren Speichern immer stärker) runterzuregeln bzw. die Vorräte von Anfang an so einteilt, dass der Katastrophenfall "komplett leere Speicher" verhindert werden kann. Unabhängig davon wie es genau funktioniert bleibt dann aber trotzdem die offene Frage: ab welchem Punkt (50%? 20%?) beginnt dieses "runterregeln" und wie stark wirkt es sich aus? Die Antwort auf diese Frage kenne ich leider nicht, das kann man nur indirekt erahnen, z.B. indem man misst, wie sich KH-Aufnahme auf die Leistung auswirkt verglichen mit Placebos. Dazu nachher noch etwas mehr.
Steffen42 hat geschrieben:Man läuft doch dem HM immer mit einem Mix aus KH und Fett.
Das stimmt, jedoch besteht dieser Mix aus ca. 90-95% KH und 5-10% Fett (siehe z.B.
https://journals.physiology.org/doi/ful ... 00855.2015), zumindest bei einem voll gelaufenen HM. Auch beim Marathon liegt man bei ca. 85-90% KH und 10-15% Fett. Je länger man braucht (und je untrainierter, was ja häufig korreliert), desto niedriger die Intensität und desto höher der Anteil an Fettverbrennung an der Energiebereitstellung.
Die zwei gebräuchlichsten Darstellungsweisen (
https://www.researchgate.net/publicatio ... d_duration bzw.
https://journals.physiology.org/doi/abs ... 3.54.2.470)
(eine weitere Darstellungsweise: siehe die Grafik unter "Fatmax Zone" hier:
https://inscyd.com/whitepaper/fatmax2018/)
Wo der "Crossover Point" (KH-Verbrauch = Fett-Verbrauch) liegt, also ob eher bei niedriger (weiter links) bzw. hoher Intensität (weiter rechts) hängt vor allem vom Trainingszustand ab.
Was jedoch klar ist: unabhängig vom Trainingszustand geht der Anteil an Fett an der gesamten Energiebereitstellung ab ca. der "aeroben Schwelle" (Intensität entsprechend dem ersten Anstieg der Blutlaktatkonzentration über die Konzentration in Ruhe) sehr stark zurück und im Bereich der "anaeroben Schwelle" (Blutlaktatkonzentration steigt auch bei gleichbleibender Intensität immer weiter an, ca. maximale Intensität, die man über 45-60' halten kann) stammt die Energie so gut wie ausschließlich von Kohlenhydraten.
Steffen42 hat geschrieben:Dass der KH-Verbrauch bei einem HM so übermäßig hoch in absoluten Zahlen sein soll, ist mir auch neu. Wie sehen die denn aus?
So sieht das aus bei Intensitäten von 31 (Dreieck), 64 (Kreis) bzw. 83 % VO2max (Quadrat) auf dem Rad (
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/ ... sp010639):
83% dürfte im Laufen ca. Marathon-Intensität bei sehr schnellen Läufern (< 2:30 h) entsprechen.
Bei Intensitäten über der Leistung @VO2max wird das KH nochmal viel schneller verbrannt:
Das sah so aus, dass die Versuchspersonen jeweils 1 min (150% der Leistung @VO2max) bzw. 3 min (120%) in der vorgegebenen Intensität gefahren sind und dann 10 min Pause gemacht haben. Das wurde 7 (120%) bzw. 8 Mal (150%) gemacht. Aber wie man sieht reichen bei entsprechender Intensität weniger als 10 Minuten an Arbeit aus, um die Glycogenspeicher fast vollständig zu entleeren.
Solche Untersuchungen wurden auch bei Läufer*innen durchgeführt (
https://journals.lww.com/acsm-msse/Full ... y,.14.aspx). Die Versuchspersonen liefen "a 10-mile road run (10-mile) at lactate threshold [~MRT+10%], 2) 8 800-m track intervals (8 800m) at velocity at VO2max [~6 min-Renntempo], and 3) 3 10-min track intervals (3 10 min) at lactate turnpoint [~MRT oder evtl. leicht schneller]." Dabei wurden jeweils direkt vor und nach dem Lauf aus der Wade (Gastrocnemius) und dem vorderen Oberschenkel (Vastus lateralis) Biopsien entnommen.
Es ergab sich ein ähnliches Bild (A,C,E: Gastrocnemius, B,D,F: Vastus lateralis) wie auch bei der obigen Untersuchung auf dem Rad:
Nach 16 km bei ca. MRT waren also bei den Männern die Glykogenspeicher in der Wade bei ungefähr 25% des Ausgangswerts und im vorderen Oberschenkel bei ungefähr 40%. Frauen verbrauchen ca. 25% weniger Glykogen (ich bin mir nicht sicher woran das liegt, müsste ich recherchieren). Hier noch die absoluten Werte des Verbrauchs.
Interessanterweise ist es übrigens auch so, dass der Körper bei nicht vollständig gefüllten Glykogenspeichern von Anfang an auch etwas weniger Kohlenhydrate verbrennt bei gleicher Intensität (gemessen am Sauerstoffverbrauch). Das deutet darauf hin, dass durchaus etwas dran sein könnte an der These mit der leistungsregulierenden Funktion des Gehirns, das dafür sorgen will, dass bis zum Ende der Anstrengung Kohlenhydrate vorhanden sind. Dadurch ist man automatisch ein klein wenig langsamer (Fettverbrennung braucht etwas mehr Sauerstoff als Kohlenhydratverbrennung). Wie viel das konkret ausmacht kann ich spontan allerdings leider auch nicht sagen.
Die entscheidende Frage ist am Ende aber natürlich trotzdem, ob die Leistungsverluste durch sich entleerende Glykogenspeicher groß genug sind um den zusätzlichen (auch zeitlichen) Aufwand der KH-Aufnahme während eines HMs zu rechtfertigen. Das wurde auch untersucht und zwar ziemlich cool, wie ich finde (
https://www.researchgate.net/publicatio ... ed_Runners). Im Endeffekt war der Leistungsunterschied (ca. 12 s) vernachlässigbar, genauso wie der Zeitverlust in den beiden Feed Zones (jeweils ca. 2 s). Wenn man allerdings die 3 Läufer rausrechnet, bei denen aufgrund der KH-Aufnahme Verdauungsprobleme auftraten, dann liegt der Unterschied zwischen Placebo und KH-Gel bei 1 min. Das ist dann alles andere als vernachlässigbar. Von daher kann es sich meiner Meinung nach durchaus lohnen, das mal auszuprobieren – vorausgesetzt man hat den Körper wirklich daran gewöhnt im Training und idealerweise dann auch bei Testwettkämpfen.
Beim Trinken sieht es übrigens ganz ähnlich aus. Man geht zwar grundsätzlich davon aus, dass ab ca. 2-3% Gewichtsverlust durch Dehydratation ein Leistungsverlust auftritt, jedoch ist es wie bei sich langsam entleerenden Glykogenspeichern auch hier nicht so, dass ab einem gewissen Punkt plötzlich ein klarer Leistungsabfall messbar ist. So lassen sich auch die Ergebnisse einer Studie erklären, die untersucht hat, ob es im Halbmarathon einen Leistungsunterschied zwischen Flüssigkeitsaufnahme nach einem festen Plan (insgesamt getrunken: 2 l -> 1.3 ± 0.7 % Gewichtsverlust) und nach Durstgefühl (insgesamt getrunken: 0.5 l -> 3.1 ± 0.6 % Gewichtsverlust) gibt (
https://www.researchgate.net/publicatio ... ce_runners).
Hier die genauen Angaben bzgl. Wasseraufnahme und -verlust:
Was die Auswirkungen auf die Leistung angeht: keine (signifikanten) Unterschiede. Genau wie bei der Studie mit den Gels beim HM wurden hier jedoch leider nur die Werte für die gesamte Gruppe angegeben. Denn meine Vermutung ist ja: es gibt relativ große interindividuelle Unterschiede. Manche haben vermutlich kein Problem mit 5% Gewichtsverlust (Haile ist Marathon-Weltrekord gelaufen mit ca. 10% Körpergewichtsverlust, also über 5 kg) während sich bei anderen schon bei 2-3 % erste negative Effekte bemerkbar machen. Dazu kommt natürlich noch, dass wir alle unterschiedlich stark schwitzen, was sich definitiv auch darauf auswirkt, wie viel man trinken muss.
 . Gut dich ein paar Höhenmeter abreißen zu sehen, die 300hm mit sicher 200 davon lange Treppen beim Firmenlauf sind kein Honigschlecken
. Gut dich ein paar Höhenmeter abreißen zu sehen, die 300hm mit sicher 200 davon lange Treppen beim Firmenlauf sind kein Honigschlecken  Mag schon sein dass es hinten Dramen gibt, vorne sind trotzdem die besten Leute aus der Region.
Mag schon sein dass es hinten Dramen gibt, vorne sind trotzdem die besten Leute aus der Region. . Wollte Rahmen nicht beschädigen. Aber nächstes Mal probiere ich noch Heißluftfön.
. Wollte Rahmen nicht beschädigen. Aber nächstes Mal probiere ich noch Heißluftfön.